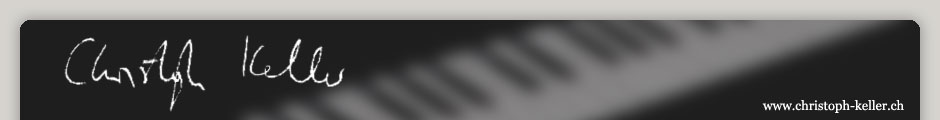Schuberts Sonate D 840. Analyse und Interpretation (fragmentarisch)
Die folgenden Überlegungen zur unvollendet gebliebenen Klaviersonate C-Dur D 840 von Schubert habe ich im Hinblick auf die anschliessende Darstellung des Werks vorgetragen; vor diesen unter dem Titel «Reliquie» bekannten zwei Sätzen spielte ich die ebenfalls fragmentarische Sonate in f-Moll von 1818. Auch zu diesem Werk machte ich einige Bemerkungen; da sie aber eher als Einführung in das wenig bekannte Werk gedacht waren, entfallen sie hier. Die Erläuterungen zur C-Dur-Sonate hingegen sollten auf die Interpretation hinführen: Ich versuchte zu zeigen, wie sich diese analytischen Überlegungen im klingenden Resultat auswirken. Dazu hatte ich die Einschränkung gemacht, dass Interpretation nicht einfach die Umsetzung analytischer Befunde ist, und es durchaus sein könnte, dass die Ausführung anders herauskommt, als die analytischen Vorbemerkungen es erwarten liessen, einmal wegen der Zufälligkeiten des Moments, aber auch, weil man selbst als Musiker nicht die nötige Distanz hat, um über die eigene Interpretation zu referieren. Es sollte aber auch gar nicht um eine Art Selbstreflexion gehen, sondern gezeigt werden, wie Analyse als Mittel der Erarbeitung eines Werkes eingesetzt werden kann, ja sogar eingesetzt werden muss, insbesondere da, wo der Notentext keine Angaben zur Ausführung macht. Das betrifft vor allem die Frage der Tempomodifikationen.
Zur Diskussion des Problems der Tempomodifikationen eignet sich Schubert ganz besonders: Er schreibt – wie in der Wiener Klassik üblich – in der Regel nur das Grundtempo, aber keine Änderungen desselben vor, und doch ist offensichtlich, dass seiner Musik ein starrer Puls nicht gerecht werden kann. Denn vor allem in den späteren Werken gestaltet Schubert auf ganz neuartige Weise Zeit: Hier ist Zeit nicht mehr ein in gleiche Kammern unterteiltes Gefäss, in das der Komponist seine Gedanken einfüllt, sondern Zeit selbst wird zum Gegenstand, zum Thema der Komposition. Die Musik läuft hier nicht mehr bloss gleichmässig ab, sondern wird ausgedehnt, gerafft, gestaut, oder steht ganz still. An den beiden vollendeten Sätzen der Sonate in C-Dur von l825 (D 840) – der dritte und vierte sind Fragment geblieben – lässt sich die Dialektik von Kontinuität und Bruch besonders schön zeigen, und eben auch die Notwendigkeit, Schuberts Zeitgestaltung durch agogische Massnahmen zu verdeutlichen.
Im ersten Satz dieser Sonate ist das Formschema des Sonatensatzes durchaus noch vorhanden, aber gerade was die Harmonik, den Tonartenplan anbelangt, doch erheblich modifiziert. Der Seitensatz dieses C-Dur-Stücks beginnt in h-Moll, die Reprise in H-Dur bzw. F-Dur – es ist gar nicht auszumachen, wo genau sie beginnt. Die Überleitungspartie der Exposition moduliert zwar ausgiebig, aber dieses Modulieren ist nicht zielgerichtet, peilt nicht eine neue stabile Tonartebene an, sondern genügt gewissermassen sich selbst. Früher ist dies Schubert oft als mangelhafte Handhabung der Sonatenform angekreidet worden. Der heutige Zeitgeist ist solch nicht-teleologischen Verfahren viel gewogener: Man würde Modulationen wie die in der Exposition der C-Dur-Sonate nicht einmal mehr als Umwege oder Ausweichungen bezeichnen, sondern schlicht als Wege – unter dem Motto: der Weg ist das Ziel.
Einen ersten solchen Weg, der vom Tonika-Zentrum wegführt, schlägt Schubert schon nach zwölf Takten ein: Er wendet den Nachsatz des Hauptthemas nach As-Dur, wiederholt die Phrase mehrmals, spaltet deren letzten Takt ab, dann nur den letzten Akkord.
Beispiel 1: 1. Satz T. 13–24
Es ist eine Liquidation thematischen Materials, wie sie sonst eigentlich nur in Durchführungen vorkommt. Hier findet sie gleich am Satzanfang statt und führt beinahe einen Stillstand herbei. Die Musik bricht richtiggehend ein; dieser Vorgang dürfte kaum sinnfällig werden, wenn der Interpret die Stelle in metronomischer Geradlinigkeit und gleichbleibender Lautstärke vorträgt. Positiv formuliert: Hier scheint eine Art morendo, also eine Reduktion von Tempo und Lautstärke bis an die Grenze des Verstummens, angebracht.
Die Musik zieht sich dann sozusagen selbst aus dem Sumpf. Durch eine crescendierende Wiederholung desselben Akkordes, mit dem sie gestrandet war, findet sie zurück nach C-Dur, zum Hauptthema. Von dort geht es nach wenigen Takten wieder weg, B-Dur, As-Dur und h-Moll werden gestreift, ehe im Takt 43 die Dominante von C erreicht ist.
Es handelt sich also wieder um eine Modulation, die dort ankommt, wo sie begonnen hat. Offenbar soll nicht ein bestimmtes Tonartziel erreicht, sondern schlicht die Musik in Fahrt gebracht werden, und dazu sind verschiedene Tonarten mindestens so gut wie eine einzige. Dieser ganze Anfang ist also vom Bewegungsablauf bestimmt: zögernder Beginn, Versanden, Wiederaufschwung, Vorwärtsdrang; die Modulationen sind eine Funktion dieses Vorgangs.
Die eigentliche Modulation – d.h. der Übergang in die Seitensatztonart – findet dagegen auf engstem Raum statt, nämlich innerhalb zweier Takte. Schubert lässt die beiden Tonarten C-Dur und h-Moll mit aller Wucht in einem einzigen dissonanten Akkord aufeinanderprallen. Er ersetzt den Grundton des Dominantnonakkords von C, das g, durch ein fis, deutet as und f enharmonisch zu gis bzw. eis um, und löst diesen Akkord in den Quartsextakkord von h-Moll auf.
Beispiel 2: 1. Satz T. 45–56
Die eigentliche Modulation kristallisiert sich also in einem einzigen dissonanten Akkord, der daher mit aller Schärfe und allem Nachdruck gespielt werden muss. Zwar fordert Schubert durch die Bezeichnung fp unmissverständlich eine Akzentuierung dieses Akkords; aber um den Akzent richtig gewichten zu können, bedarf es wohl doch der Einsicht in die Schlüsselfunktion dieses Akkordes.
Wir haben also zwei herausragende, frappante Ereignisse in diesem Sonatenbeginn: zum einen der zum Versanden führende Abspaltungsprozess gleich zu Beginn, zum andern die schroffe Wendung in eine nach Quintenzirkel recht weit entfernte Tonart. Frappantes kann nicht wiederholt werden, ohne dass es an Wirkung einbüsst, und doch möchte Schubert die ganze Exposition wiederholt haben. Nun, die Wiederholung könnte man ja weglassen. Aber was ist mit der Reprise? Die Analyse wird zeigen, dass Schubert selbst den Pfeffer herausnimmt; da der Effekt der Exposition kaum gesteigert werden könnte, bleibt eigentlich auch gar nichts anderes übrig als bewusst abzuschwächen. Schubert rafft das Versanden in der Reprise derart, dass es kaum mehr ein Versanden ist, sondern nur noch die Erinnerung daran. Um nicht weniger als fünf Takte ist die Reprise gegenüber der parallelen Stelle in der Exposition gekürzt.
Beispiel 3: 1. Satz T. 172–179
Den Übergang in den Seitensatz, der in der Exposition gerade durch seine knappe Schärfe bei grosser harmonischer Distanz charakterisiert war, baut Schubert dagegen aus, obwohl die harmonische Distanz in der Reprise auf Null geschrumpft ist: Das a-Moll des Seitensatzes ist schon vor jener Stelle erreicht, an der in der Exposition der krasse Wechsel C-Dur/h-Moll stattfand. Dafür umfasst der Übergang paradoxerweise zwölf Takte gegenüber den acht Takten der Parallelstelle der Exposition.
Beispiel 4: 1. Satz T. 202–214
An der Stelle des stark dissonanten Vorhaltsakkords der Exposition (T. 51) steht in der Reprise (T. 212) ein gewöhnlicher Dominantseptakkord. Schubert bezeichnet diesen Dominantseptakkord ebenfalls mit fp, aber er sollte wohl entsprechend dem weit geringeren Dissonanzgrad um einiges weicher angeschlagen werden. Auch kann er, da nichts Spektakuläres passiert, auf die vorgeschriebene Dauer von zwei Vierteln beschränkt werden, während die Schlüsselfunktion des entsprechenden Akkords in der Exposition eine leichte Dehnung nahelegt. Hier haben wir einen der Fälle, wo der Text allein keine genügende Auskunft über eine sinnvolle Interpretation gibt, wo es der Analyse bedarf, um dem musikalischen Verlauf in der Darstellung gerecht zu werden.
Ich fasse zusammen: Schubert will nicht in der Reprise das Einmalige der Exposition überbieten, sondern im Gegenteil: er nimmt es zurück, schwächt es ab. Das Festfahren und Abbröckeln im Hauptsatz rafft er, und umgekehrt mildert er den schroffen Übergang zum Seitensatz durch Ausdehnung und geringeren Dissonanzgrad. Dieses kompositorische Verfahren gibt dem Interpreten auch einen Hinweis auf eine mögliche Gestaltung der Expositions-wiederholung. So wie Schubert das Versanden in der Reprise nur mehr andeutet, könnte die Expositionswiederholung gewissermassen als Referat der 1. Exposition vorgetragen werden, sozusagen in Anführungszeichen: «So war die Exposition» – selbstverständlich ohne Kürzungen seitens des Interpreten, aber mit Raffungen, was das Ausspielen der Vorgänge betrifft, mit einem leicht schnelleren Tempo insgesamt, vor allem am Anfang: Nachdem das Hauptthema in der forte-Version bereits in zügigem Tempo erschienen ist, würde es wenig Sinn machen, bei der Expositionswiederholung das ursprüngliche, zögernde Tempo wiederaufzugreifen – sofern man denn überhaupt mit einem zögernden Tempo beginnt, und nicht den grundsätzlichen Verzicht auf Tempomodifikationen fordert, die nicht von Schubert vorgeschrieben sind, wie dies etwa der Dirigent Roger Norrington mit Berufung auf authentische Quellen tut1. Hierzu sei nur angemerkt, dass die Aufzeichnungen von Ferdinand Luib und Leopold von Sonnleithner, auf die Norrington wohl anspielt, sich auf den Vortrag von Liedern beziehen, auf einen Vortrag offenbar, der den lyrischen Charakter des Schubertschen Lieds durch übertriebene Deklamatorik und Dramatik entstellte. Dass Schubert als Liedbegleiter – wie Luib berichtet – stets das «strengste gleiche Zeitmass» einhielt, «ausser in den wenigen Fällen, wo er ausdrücklich ein ritardando, morendo, accelerando ect. schriftlich angezeigt hatte»2, gestattet allerdings keinen direkten Schluss auf den Vortrag von Sonaten und Symphonien, umso mehr, als der andere Zeuge, Sonnleithner, die Notwendigkeit eines konstanten Zeitmasses von der Semantik der Liedbegleitungen her begründet: «Ein im Trabe oder Galoppe laufendes Pferd lässt sich nicht aus dem Takte bringen; ein laufendes Spinnrad kann wohl stehen bleiben, wenn die Spinnerin, von Leidenschaft bewegt, in einem Augenblicke vergisst, es anzutreiben, es kann aber unmöglich in einer Sekunde schnell und in der nächsten langsam laufen, und so taktweise abwechseln.»3 Man merkt, gegen welche Art von Agogik sich diese sicher authentischen Äusserungen richten: gegen ein willkürliches Hin und Her, jenes allgemeine Schwanken des Tempos, das Schumann mit dem Gang eines Betrunkenen verglich.
Dem soll hier sicher nicht das Wort geredet werden. Im Gegenteil: Auch wenn man Tempomodifikationen für ein wichtiges Mittel einer sinnvollen, formgliedernden Darstellung hält, sollten sie sich bei Schubert in einem relativ engen Rahmen halten. Denn gegen die Brüche hat Schubert Elemente gesetzt, welche die Kontinuität betonen. Dass das Versanden und Wiederaufrappeln am Anfang der Exposition auf ein und demselben Akkord passiert, wurde schon erwähnt (vgl. Beispiel 1). Und die Schnittstelle C-dur/h-Moll überbrückt Schubert mit einem durch Synkope plus drei repetierte Achtel chrakterisierten Motiv, das als Begleitmotiv bei der forte-Version des Hauptthemas erscheint (T. 29 ff.), dann durch Abspaltung und Sequenzierung von dessen letztem Takt in den Vordergrund rückt, in den T. 45–48 und 53/54 die Szene allein beherrscht, ehe es wieder zum Begleitmotiv wird, jetzt des zweiten Themas (vgl. Beispiel 2). Dabei sind die drei repetierten Achtel selbst aus dem Hauptthema abgeleitet: als Abspaltung von dessen letztem Takt werden sie zum Motiv.
Beispiel 5: 1. Satz T. 7/8 und 19–21
Im Seitensatz dient dieses (um den synkopierten Viertel erweiterte) Achtelmotiv zunächst als Begleitung; T. 71ff. emanzipiert es sich von dieser Funktion, wird zur Hauptsache, und ab T. 86, wo das Seitensatz-Thema nun regelkonform in G-Dur erscheint, wieder zum Begleitmotiv.
Ich meine nun keineswegs, dass dieses Motiv als vereinheitlichendes Moment die Hauptsache und als solche hervorzuheben wäre; Schubert benutzt dieses Motiv nur, um seiner Sonatenkomposition auf einer sekundären Ebene Zusammenhalt zu verschaffen, während die primäre von Diskontinuitäten und Paradoxa durchsetzt ist. Trotzdem: Die vereinheitlichende Funktion von Motiven kommt nur dann zum Tragen, wenn die Fluktuationen des Tempos einen bestimmten Rahmen nicht überschreiten. Und diese Dialektik von Diskontinuität und Kontinuität scheint mir für Schuberts Sonatenkomposition essentiell; auf deren adäquate Realisierung hat der Interpret in erster Linie zu achten bei der Gestaltung der Zeitdimension dieses Werkes.
Von Brüchen durchsetzt ist auch der 2. Satz, und dies im Rahmen einer symmetrischen A-B-A-B-A-Form. Für den B-Teil
Beispiel 6: 2. Satz T. 23–54
ist das Ineinander von Kontinuität und Diskontinuität geradezu konstitutiv. Es ist also nicht eine einprägsame thematische Formulierung, die diesem Teil das Gesicht gibt, im Gegenteil: die Thematik ist formelhaft, wickelt sich fast routinehaft in Sequenzen ab. Umso mehr lassen in T. 33/34 die scharfen Attacken und rasanten Figuren aufhorchen, die diese Gleichförmigkeit aufbrechen. Auf diesen Ausbruch folgt nach einer vergleichsweise langen Pause T. 35 ein schüchterner Neubeginn, der – gerade nachdem er nach As-Dur zurückgefunden hat (T. 37) – erneut abdriftet, diesmal auch harmonisch: nach E-Dur (T. 39). E-Dur wird dann in T. 40 enharmonisch umgedeutet nach Fes-Dur, und als VI. Stufe von as-Moll zurückgeführt nach As-Dur. Es erscheint wieder das formelhafte Ausgangsmaterial dieses B-Teils, nun aber nicht mehr in zweitaktigen, durch Pausen getrennten Phrasen wie am Anfang, sondern in ununterbrochener Kontinuität über mehr als acht Takte. Das Motiv des B-Teils leitet dann (T. 50ff.) über in die (variierte) Reprise des A-Teils und kontrapunktiert dessen Thema (T. 53ff.).
Die volle Kontinuität entfaltet sich also erst nach den beiden Brüchen, stellt sich durch die Diskontinuität hindurch her. Ich meine, dass dieser Prozess (Kontinuität – Bruch – Versuch der Wiederherstellung von Kontinuität – erneuter, noch stärkerer Bruch – gesteigerte Kontinuität) die Idee des B-Teils ausmacht und vom Interpreten entsprechend realisiert werden muss. Während der Text über die dazu notwendigen dynamischen Massnahmen relativ genaue Angaben macht, bleibt die Umsetzung in agogischer Hinsicht ganz dem Interpreten überlassen. Sicher würde ein gleichförmiges Spiel hier eine Kontinuität suggerieren, die eben nur die eine Seite dieser Musik ausmacht. Nötig scheint mir in erster Linie ein zögerndes Wiederaufnehmen des Tempos nach den Pausen, die auf die beiden Ausbrüche folgen, beim zweiten Mal ausgeprägter als beim ersten Mal, entsprechend der grösseren harmonischen Entfernung. Ein solch stärkeres Zögern würde auch die volle Entfaltung der Kontinuität am Schluss erst recht deutlich machen.
Zusammengefasst: Kontinuität und Diskontinuität, Konsequenz und Bruch sind in diesem Werk auf eine Weise realisiert, die Schubert als genialen Erneuerer der Sonatenform erweisen, indem die Dialektik der Sonatenkomposition nicht bloss als Entgegensetzung und Vermittlung von thematischen Bildungen, von Charakteren usw. verstanden wird, sondern eben auf jener Ebene verwirklicht wird, die das eigentliche Element der Musik ist: in der Gestaltung von Zeit – eine Erkenntnis, die sich spätestens seit Dieter Schnebels Schubert-Aufsatz von 1968/69 «Auf der Suche nach der befreiten Zeit»4 allmählich durchgesetzt hat und die frühere, am Beethovenschen Prototyp orientierte Kritik am Sonatenkomponisten Schubert, wie sie paradigmatisch von Hans Költzsch5 formuliert wurde, ins Reich der obsoleten Urteile verwiesen hat.
1im Booklet zu seiner Aufnahme von Schuberts 9. Symphonie mit den London Classical Players, EMI CDC 7 49949 2
2Otto Erich Deutsch (Hg.): Schubert. Die Erinnerungen seiner Freunde, Leipzig 1957, S. 98
3ebenda, S. 292
4in: "Denkbare Musik. Schriften 1952–1972", Köln 1972, S. 116–129
5in: "Franz Schubert in seinen Klaviersonaten", Leipzig 1927
© 2009 Christoph Keller. Alle Rechte vorbehalten.