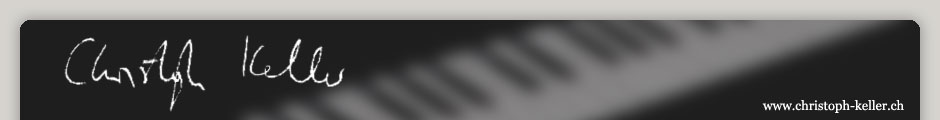Zum semantischen Aspekt von Opernparaphrasen an Beispielen von Thalberg, Liszt und Busoni
Die Opernparaphrasen bzw. das Potpourri gehören zu jenen musikalischen Gattungen, die statt im Museum auf dem Müllhaufen der Geschichte gelandet sind. Für die Popularisierung der Oper sorgen heute TV-Übertragungen und Schallplattenaufnahmen; die Highlights müssen nicht mehr am Klavier nachbuchstabiert werden, sondern werden von Pavarotti, Domingo & Co. frei Haus geliefert. Die Virtuosität von Paraphrasen ist – unter dem Aspekt der Entwicklung des Klaviersatzes – nur noch von historischem Interesse; hingegen könnte eine Untersuchung des Verhältnisses von Paraphrasen zu den betreffenden Opernvorlagen Beiträge zu einer Semantik von Instrumentalmusik liefern, die über das Genre hinaus von Interesse sind. Im folgenden werden semantische Aspekte an Don Giovanni-Paraphrasen von Thalberg und Liszt, an einer Wagner-Bearbeitung Liszts und an Busonis Carmen-Fantasie aufgezeigt.
Klavierbearbeitungen von Opern – das waren Potpourris für den Hausgebrauch einerseits und Paraphrasen fürs Konzertpodium anderseits – dürften im 19. Jahrhundert mindestens so viel für die Verbreitung der Oper geleistet haben wie Bühnenaufführungen. Heute haben andere Medien die Popularisierung des Genres übernommen; die Klavierbearbeitungen, die meist mit wenig Kunstanspruch für den aktuellen Markt geschrieben wurden, haben diesen verloren. Sie sind bloss noch ein historisches Phänomen, aber als solches durchaus von Interesse. So haben die Paraphrasen wesentlich zur Entwicklung des Klaviersatzes im 19. Jahrhundert beigetragen. Die Notwendigkeit, ein erkennbares Thema und grösstmögliche Virtuosität in zwei Händen unterzubringen, hat Spieltechniken hervorgebracht, welche den Schein erweckten, als würde – wie Schumann in bezug auf Thalbergs "Moses–Fantasie" formulierte – "der Spieler sich verdoppeln, als möchte das Instrument ein neues gebären". Doch soll hier das Thema "Opernparaphrase" nicht vom Klavier, sondern von der Oper her angegangen werden. Es geht also nicht um den pianistischen Umgang mit der Oper; sondern es soll an einigen Beispielen der Frage nachgegangen wer-den, wie die Oper das Klavierstück prägt, welchen Inhalt sie in das Instrumentalwerk hineinträgt. Mit andern Worten: Es geht um die semantische Dimension von Opernparaphrasen, die dadurch, dass sie Opernthemen zitieren, immer auch auf deren Inhalt verweisen, diesen in einer bestimmten Weise beleuchten oder gar kommentieren. Der Gehalt von Opernparaphrasen wäre dann auch unter dem Aspekt zu beurteilen, in welchem Masse diese Dimension vom Komponisten bewusst gestaltet wird; ob er einige populäre Themen einfach zusammenklebt oder ob er mit ihnen eine Geschichte erzählt oder einen inhaltlichen Zusammenhang herstellt. Dass Liszt, der symphonische Dichter, einen wachen Sinn auch für die semantische Dimension von Opernparaphrasen hatte, liegt auf der Hand. Doch wie verhält es sich bei Thalberg, seinem Gegenspieler? Einem Gegenspieler von solchem Gewicht damals, dass Eduard Hanslick dem Abschnitt "Die Virtuosenzeit 1830–1850" seiner "Geschichte des Concertwesens in Wien" den Untertitel "Die Epoche Liszt-Thalberg" gab; doch schon bei Erscheinen des Buches von Hanslick 1869 waren Thalbergs Stücke aus dem Repertoire verschwunden – "mit einigem Unrecht", wie Hanslick bemerkt. Immerhin hatte Schumann in der schon zitierten Rezension geschrieben: "Vergleicht man einen solchen Konzertsatz [Thalbergs Fantasie über Rossinis "Moses") mit welchen aus früheren Zeiten, die auf die gleiche Wirkung berechnet waren, so können wir uns noch immer Glück wünschen, dass auch in der Salonmusik an die Stelle gänzlicher Unfruchtbarkeit und Inhaltslosigkeit, wie sie sich z.B. in Gelinek, später in Czerny zeigt, ein Ideenvolleres, mehr künstlerisch Kombinierendes getreten ist, und in dieser besseren Art der Salonmusik mag denn auch Thalberg als Matador gelten." Worin dieses Ideenvolle, künstlerisch Kombinierende besteht, sei im folgenden an einem andern Werk von Thalberg untersucht, der "Don Giovanni"-Fantasie, genauer: Sérénade et Menuet de 1' Opéra Don Giovanni variés pour le Piano par Sigismund Thalberg opus 42.
Don Giovanni: Thalbergs Maskenspiel…
Diese beiden Stücke, die Serenade und das Menuett aus Mozarts Oper, verbindet weniger eine musikalische als eine inhaltliche Gemeinsamkeit: Beide sind Musik zu Maskenszenen. Das Menuett erscheint beim maskierten Auftritt von Donna Anna, Donna Elvira und Don Ottavio im Finale des 1. Aktes; die Serenade wird von Don Giovanni als Leporello verkleidet vorgetragen. Diesen gemeinsamen Nenner hat Thalberg zum Anlass genommen, seinerseits eine musikalische Maskerade zu veranstalten. Er beginnt mit einer Einleitung, die zunächst die Melodie der Serenade anklingen lässt (Beispiel 1)

und fährt dann in der Art einer freien Fantasie weiter. Nach etwas mehr als zwanzig Takten erreicht er den Ruhepunkt der Dominante, worauf normalerweise das originale Opernthema exponiert werden müsste. Stattdessen aber bringt Thalberg ein Thema, das weder mit der Serenade noch mit dem Menuett aus "Don Giovanni" irgendetwas zu tun zu haben scheint (Beispiel 2)

Auch nachdem dieses Thema zu Ende geführt ist, macht er keine Anstalten, "Don Giovanni" zu zitieren, sondern führt ein neues Thema in der Dominant-Tonart ein (Beispiel 3).

Nach einigen harmonischen Ausweichungen setzt auf der Dominante abermals ein neues Thema ein (Beispiel 4),

immer noch nicht eines der angekündigten Stücke, aber immerhin ein Zitat aus "Don Giovanni", nämlich aus Zerlinas Arie "Vedrai carino" (Beispiel 5).
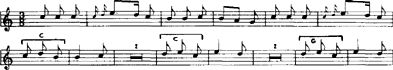
Das Zerlina-Thema verschwindet aber schon nach zwölf Takten wieder, und nach einigen virtuosen Eskapaden setzt Thalberg zur Reprise seines eigenen Themas (Beispiel 2) an. Nachdem er dieses mit Ketten von Tonrepetitionen über die halbe Klaviatur garniert hat, lässt er es in einer Weise kulminieren, die glauben macht, die "Don Giovanni"-Fantasie käme zu ihrem Ende, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat. Just an dieser Stelle meldet sich nun erstmals das Menuett-Thema zu Wort – ziemlich unauffällig als Mittelstimme (Beispiel 6).

Nun steuert Thalberg erneut auf die öffnende Dominante – und diesmal wirklich auf Mozart – zu, aber nicht auf das eben angetippte Menuett, sondern – um das Verwirrspiel doch noch nicht ganz aufzugeben – erst einmal auf die Serenade. Das Menuett kommt erst wieder, nachdem die Serenade – umrankt von den Mandolinenfiguren Mozarts, von chromatischen Tonleitern und Oktaven – einige Male in E-Dur und e-moll erklungen ist, und muss sich erst noch gefallen lassen, sozusagen beiläufig, in einer Modulation, die auf eine As-Dur-Version des Serenadenthemas hinführt, wiedereingeführt zu werden. Dafür hat das Menuett mit Tonleiterpassagen aufwärts und abwärts über die ganze Klaviatur den triumphalen Schluss ganz für sich.
Während die Variationen über die beiden Themen konventionell und höchstens unter dem Aspekt des Klaviersatzes von Interesse sind, verdient die aussergewöhnlich umfangreiche Einleitung eine genauere Betrachtung, weil es sich hier um mehr handelt als blosses Präludieren. Denn ganz beziehungslos zu "Don Giovanni" sind diese fast 150 Takte nicht: So wie sich unter den Kleidern Leporellos Don Giovanni verbirgt und die signore maschere sich als das adlige Trio Anna/Elvira/Ottavio entpuppen, lassen sich nämlich unter der Thalberg-Melodik die entsprechenden Mozart-Themen ausfindig machen. Die Folge Dominantton-Grundton-Dominantton; von der Thalberg ausgeht (Beispiel 2, Klammer a), entspricht der markanten Quartbewegung im zweiten Takt des Mozart-Menuetts – besonders markant deshalb, weil die Quarte auf eine Reihe von Tonwiederholungen folgt und im ganzen Thema der grösste Schritt bleibt (Beispiel 7, a).

Mit einem Quartschritt vom Dominantton zum Grundton beginnt auch die Serenade (Beispiel 8, a);

er wird mit einem absteigenden Terzgang fortgesetzt (b), der ebenfalls mehrmals wiederkehrt und den Thalberg zum Motiv seines H-Dur-Teils macht (Beispiel 3, b). Drittes Motiv des Serenadenthemas schliesslich ist die Intervallfolge Sekunde aufwärts-Terz abwärts (Beispiel 8, c); mit ihr beginnt Thalbergs drittes Thema (Beispiel 4, c) – aber halt! – das war doch der Balsam, den Zerlina ihrem Masetto verabreicht (Beispiel 5) und nicht Don Giovannis Honig für Zerlina! Thalberg wirft sozusagen beides in einen Topf, aber es ist Mozart, der ihm das Motiv dazu liefert. Wenn man will, kann man diese Intervallkonstellation übrigens auch im Menuett (Beispiel 7, c) ausfindig machen, den Terzgang ebenso, sogar in derselben punktierten, aufwärts gerichteten Version wie bei Thalberg (Beispiel 3 bzw. 7, b') – die Entlarvung der Maskerade nimmt kein Ende... Was sind bewusst hergestellte, was zufällige Ubereinstimmungen? Diese Frage ist letztlich so müssig wie die, ob Don Giovanni Leporello nur ähnlich sieht, weil er sich dessen Kleider geborgt hat, oder auch, weil ihn seine Erbmasse zufällig mit einer ähnlichen Nase ausgestattet hat.
Thalberg setzt also Motivverwandlung in Instrumentalmusik in Analogie zum Maskenspiel der Oper. So wie die Darsteller sich zwecks Täuschung verkleiden, kleidet er Motivmaterial aus "Don Giovanni" so ein, dass dessen Ursprung unkenntlich erscheint. Hinter der szenischen Gemeinsamkeit von Serenade und Menuett spürt er motivische Gemeinsamkeiten der beiden Nummern auf und macht diese zum Ausgangspunkt seiner musikalischen Maskerade.
...und Liszts Moral
Treibt Thalberg mit Mozarts "Don Giovanni"-Themen ein Spiel, das zum Spiel der Oper ein Analogon schafft, aber weiter nichts bedeutet, so nimmt Liszt in seinen "Réminiscences de Don Juan" die inhaltliche Dimension der zitierten Stellen in Anspruch, um seine eigene Lesart der Oper zu geben. Bei ihm hat der Commendatore das erste und das letzte Wort. Die Paraphrase beginnt und endet mit der Erscheinung der Statue, der Musik zu den Worten: "Di rider finirai pria dell'aurora" ("Das Lachen wird dir noch vor der Morgenröte vergehen"), mit denen der Commendatore die tödliche Strafe für Don Giovanni ankündet. Nach einer längeren Fantasie über Material aus der Finalszene, welche Don Giovannis Versinken im Feuer vorangeht, folgen Variationen über das Verführungsduett "Là ci darem la mano". Aber schon die zweite dieser Variationen kippt wieder in die Finalszene um, und zwar auf die Worte des Commendatore "Tu m'invitasti a cena, il tuo dover or sai" ("Du hast mich zum Essen eingeladen, deine Pflicht kennst du nun"). Doch Don Giovanni weiss auch in Liszts Paraphrase nicht, was seine Pflicht ist: es tauchen erneut Fragmente aus dem Duett mit Zerlina auf, und schliesslich folgt auch noch seine Weinarie – mit der Konsequenz, dass im fortefortissimo und abschliessend nochmals die Verdammung durch die sprechende Statue zitiert wird. Liszts Moral: Nix Wein, Weib und Gesang! Bereue deine Sünden oder du landest im Höllenfeuer!
Wagner-Liszts Meistersinger: Zu eignem Lob und Preis
In späteren Jahren, als er seine Virtuosentätigkeit aufgegeben hatte, hörte Liszt keineswegs auf, Opernparaphrasen zu schreiben – ein Indiz dafür, dass es ihm dabei niemals bloss um virtuose Selbstdarstellung gegangen war. Doch verlagerte sich das Schwergewicht von der hochvirtuosen Fantasie über verschiedene Themen (wie noch in den "Réminiscences de Don Juan") zur vergleichsweise schlichten Bearbeitung eines bestimmten Ausschnittes einer Oper. Dies steht in engem Zusammenhang mit seiner Hinwendung zu Richard Wagner. Seine persönliche wie ästhetische Verbundenheit mit Wagner hat ihn zu einer ganzen Anzahl Bearbeitungen veranlasst, die meistens getreu der Vorlage folgen, diese möglichst adäquat und wirkungsvoll für Klavier adaptieren, um der Musik des umstrittenen Bayreuther Meisters zu grösserer Verbreitung zu verhelfen. Die Bearbeitung von "Am stillen Herd" aus "Die Meistersinger von Nürnberg", die im folgenden näher betrachtet wird, folgt zwar nicht Note für Note dem Original – was hier auch wenig sinnvoll wäre, da der musikalische Verlauf dieser Szene weitgehend von der verbalen Auseinandersetzung bestimmt ist –; sie hält aber der Vorlage in einem solchen Masse die Treue, dass sie geradezu zu einer Wagner-Apologie gerät.
Da es hier ganz wesentlich um den Inhalt geht, sei dieser kurz rekapituliert:
Der Ritter Walther von Stolzing liebt Eva, kann diese aber nur bekommen, wenn er aus dem Meistersinger-Wettbewerb als Sieger hervorgeht. Seine Auffassung von Liedkunst widerspricht jedoch den von den Meistersingern etablierten und von Beckmesser pedantisch überwachten Regeln: Auf solche Schulregeln pfeift nämlich Walther, der seine Kunst bei "von der Vogelweid" und "auf der Vogelweid", von "Dichtersanges Wundermacht", von "Winternacht und Waldespracht", von "Rosses Schritt beim Waffenritt" und "Reihentanz bei heit'rem Schanz" gelernt hat. Kurzum: Er beruft sich auf die Natur als Lehrmeisterin und auf das (mystifizierte) Mittelalter. Demgegenüber erscheint Beckmesser als kleinkarierter Pedant, der dem erhabenen Diskurs des Herrn von Stolzing nichts als spöttische Zwischenrufe entgegenzusetzen weiss. In dieser Gegenüberstellung versteckt sich die Auseinandersetzung der "neudeutschen" Richtung Wagners und Liszts mit dem theoretisch durch Hanslick und praktisch durch Brahms repräsentierten Klassizismus. (Eduard Hanslick definierte bekanntlich in seiner Abhandlung "Vom Musikalisch Schönen" die Musik als "tönend bewegte Form" und bestritt die Möglichkeit der Musik, Inhalte wiederzugeben oder Natur abzubilden, energisch.) Dem Brahms-Hanslickschen Klassizismus, in der Regelversessenheit Beckmessers karikiert, setzt Wagner die Berufung auf den mittelalterlichen Walther von der Vogelweide entgegen. Dessen Namen nimmt er mit einem pseudoetymologischen Sprachtrick für seine Naturkunstideologie in Anspruch. Er lässt seinen Walther nämlich nicht nur singen: "Herr Walther von der Vogelweid, der ist mein Meister gewesen", sondern auch: "Im Wald dort auf der Vogelweid, da lernt ich auch das Singen", wozu denn prompt die Streicher so trillern, wie Wagner sich das Zwitschern von Vögeln vorstellt.
In Liszts Bearbeitung dieser Szene sind nun alle Elemente des Widerspruchs, wie sie sich in den Einwürfen Beckmessers und Kothners manifestieren, getilgt. Bei Liszt feiert Walther von Stolzing den Sieg, ohne dass es zur Prüfung kommt. Diese Apologie – zugleich Selbstapologie – lässt sich bis ins Detail verfolgen. So schiebt Liszt zwischen "Das schallte laut in Waldespracht, das hört ich hell erklingen" und "Im Wald dort auf der Vogelweid, da lernt ich auch das Singen" eine virtuose Kadenz ein und erklärt so seine eigene Virtuosität gewissermassen zum Naturereignis. – Eine andere Stelle: "Ein altes Buch, vom Ahn vermacht, gab das mir oft zu lesen: Herr Walther von der Vogelweid, der ist mein Meister gewesen." Hier verrät uns Liszt durch einen Einschub (Beispiel 9),

was in dem alten Buch zu lesen ist: offenbar ein Motiv von Wagner, denn der Einschub greift auf die Einleitung zurück, in der jenes aus der zweiten Gesangsphrase ("in Winterszeit") abgeleitete Motiv exponiert wird (Beispiel 10).

Dieses Motiv macht Liszt damit zum Symbol der Identifikation Wagners mit dem Mittelalter Da diese Identifikation für "Die Meistersinger von Nürnberg" zentral ist, ist es nur konsequent, dass Liszt die Bedeutung dieses Motivs gegenüber der Vorlage erheblich steigert. Es erscheint (variiert) als Überleitungselement und als Nebenstimme (Beispiel 11),

und es erscheint vor allem am triumphalen Schluss, den Sieg von Walthers/Wagners Vogelweid-Ideologie symbolisierend (Beispiel 12).

Da diese Szene eher arm an musikalischen Gestalten ist, konnte sie von Liszt nicht tel quel aufs Klavier übertragen werden. Er löst dieses Problem, indem er Walthers Gesang in verschiedene Tonarten transponiert und – wie an einem Ausschnitt (Beispiel 11) gezeigt – mit Nebenstimmen und Begleitfiguren umrankt und auch den Klangcharakter variiert. Er gewinnt so der musikalischen Einfalt einen gewissen Farbenreichtum ab und macht diesen zugleich seiner apologetischen Konzeption zunutze: Nach den entlegenen Episoden tritt die D-Dur-Grundtonart am Schluss umso strahlender in Erscheinung.
Carmen: Busonis Versöhnung des Unversöhnlichen
Es dürfte nicht viele Paraphrasen geben, die sostenuto und lento, languendo und mancando enden: Busonis "Carmen"-Paraphrase von 1922, die verklingt, als möchte der Tastenlöwe den Applaus für die vorangegangenen Anstrengungen möglichst vermeiden, ist eben eine Spätblüte der Gattung oder sogar eine Hommage an ein bereits verblichenes Genre.
Keine andere Oper hat wahrscheinlich für so viele Potpourris in allen möglichen Besetzungen herhalten müssen wie Bizets "Carmen". Auch Busoni benutzt die populärsten Nummern: Die allbekannte Habañera fehlt ebensowenig wie die reisserische Introduktion zum 1. Akt und der schmissige Chor der Verkäuferinnen und Verkäufer aus dem 4., und auch den Schmelz der Blumenarie verschmäht er nicht. Aber Busoni setzt der willkürlichen Reihung der beliebtesten Melodien, wie sie im Potpourri üblich ist, ein strenges Formgefüge entgegen, und seine konzisen Formulierungen vermeiden die ausufernde Virtuosität podiumsgerechter Paraphrasen – er nennt denn auch seine Carmen-Bearbeitung ganz bewusst "Kammer-Fantasie". Die Opernparaphrase wird sozusagen einer klassizistischen Reinigung unterzogen. Die vier Stücke sind in der Art einer viersätzigen Sonate angeordnet: Zwei schnelle Ecksätze in der Haupttonart A-Dur (denen der VerkäuferInnenchor bzw. die Introduktion zugrunde liegen) umrahmen einen langsamen Satz in Des-Dur (Blumenarie) und ein Scherzo in Des-Dur/d-Moll (Habañera). Busoni hat die vier attacca zu spielenden, durch Modulationen verbundenen Sätze denn auch als "Sonatine" bezeichnet und als letzte Nummer in seinen Zyklus von sechs Sonatinen eingefügt.
Doch weniger dieser formale Aspekt soll uns hier beschäftigen als die Frage, ob es auch inhaltlich eine Verknüpfung gibt. Gehen wir von hinten – von der Coda – aus: dort gibt es eine Motivverknüpfung, die in Bizets Oper nicht vorkommt. In diesem "Andante visionario" kombiniert Busoni eine chromatische Abwärtsbewegung in der linken Hand mit einem durch die übermässige Sekunde geprägten Motiv in der rechten (Beispiel 13).

Dieses Motiv steht in der Oper für Don Josés Besessenheit und deren tödliche Konsequenz für Carmen; die Chromatik verweist auf die Habañera, in der Carmen ihr Verständnis von Liebe darlegt: "L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser" ("Die Liebe ist ein rebellischer Vogel, den nichts zähmen kann") und "L'amour est enfant de Bohême, il n'a jamais connu de loi" ("Die Liebe ist ein Kind der Boheme, sie hat nie ein Gesetz gekannt"). Beide Motive exponiert Busoni in den Mittelsätzen: Das Motiv mit der übermässigen Sekunde erscheint erstmals am Ende des 2. Satzes, also der Blumenarie, und weist so schon auf die fatale Konsequenz von Don Josés Huldigung hin; die Habañera liegt – wie erwähnt – dem 3. Satz zugrunde. In diesen beiden Sätzen wird also – liest man den Text der Oper mit – auf die unvereinbaren Haltungen der Protagonisten verwiesen: auf Don Josés besitzergreifende Liebe zu Carmen, und auf Carmens freie, ungebundene Liebe. Der 4. Satz geht von jenem Stück aus, das als Begleitmusik zu Escamillos siegreichem Stierkampf immer wieder von ferne in die Ausein-andersetzung von Carmen und Don José hereintönt. Don José bringt ja Carmen um, weil sie ihn zugunsten Escamillos verlassen hat. In der Oper endet der Konflikt tödlich, Busoni aber führt die Motive Don Josés und Carmens –übermässige Sekunde bzw. Chromatik – in der Coda des 4. Satzes zu einer imaginären Versöhnung.
Busoni bereichert so den Carmen-Extrakt um die Vision einer Versöhnung des Unversöhnlichen, die dem abrupten, realistischen Ende der Oper krass widerspricht und eher an eine Vereinigung im Tode wie in "Tristan und Isolde" denken lässt. Ob Busoni aber Bizet mystifizieren oder gar eine eigene Vision einer sowohl besessenen wie freien Liebe symbolisieren wollte, gehört zu jenen Fragen, welche die ausgeklügeltste Semantik der Instrumentalmusik nicht beantworten kann – überdies: nach Hanslick würde es sich hier um nichts weiteres als eine Motivkombination handeln…
© 2009 Christoph Keller. Alle Rechte vorbehalten.