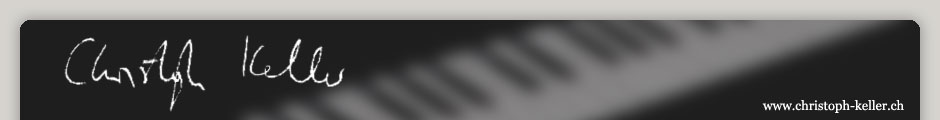Neue Musik und Popularität: Kritische Überlegungen am Beispiel ex-sowjetischer Komponist(inn)en und Pendereckis
"Auf Gedeih und Verderb hat das gewöhnliche Volk im 20. Jahrhundert die Geschichte als kollektiver Akteur in eigener Sache betreten" – so fasst der Historiker Eric Hobsbawm das abgelaufene Jahrhundert zusammen.1 Nachdem sich der Kapitalismus in den 90er Jahren global durchgesetzt hat, ist es mehr denn je der vielbeschworene "Markt", über den das "Volk" mit der Summe seiner individuellen Entscheidungen kollektiv agiert. Beinahe alles ist zum "Produkt" geworden, das sich dem Verdikt des Marktes zu stellen hat, sogar die Politiker selbst: am erfolgreichsten sind gerade jene, die ihre Vor- und Darstellungen exakt nach den Ergebnissen der Marktforschung ausrichten. Auf diese Weise, und nicht etwa mit Hilfe kollektiv agierender Arbeitermassen, hat bekanntlich Tony Blair die englische Labour Party – und vor allem sich selbst – an die Macht gebracht. Die Marktforschung ist zur Boombranche mit anhaltend steilem Aufwärtstrend geworden.2 So wie heute schon mit Cumulus- und anderen Superkarten exakte Kundenprofile erstellt werden, werden bald einmal auf einem Chip gespeicherte Tickets ermöglichen, die musikalischen Vorlieben von Konzertgängern genau zu erfassen. Komponieren solle eine Dienstleistung wie andere auch sein, und Anpassung an den Publikumsgeschmack müsse wieder zur Selbstverständlichkeit werden, postuliert der Musikwissenschafter Mathias Spohr, selbst auch Komponist, und sieht die avantgardistische Musikkultur folgerichtig im Banne eines überlebten romantischen Geniekults.3
Nun gibt es zwar im Bereich der neuen E-Musik dank schlecht bis gar nicht bezahlter Arbeit und staatlichen Subventionen ein paar Werkstätten, deren Produkte nicht gekauft zu werden brauchen. Doch neuerdings rechnet man nicht nur bei Opernhäusern, sondern auch bei Konzertzyklen mit zeitgenössischer Musik den Betrag aus, welchen der Staat pro verkauftes Eintrittbillett zuschiesst. Der künstlerische Leiter einer solchen Reihe sagte mir kürzlich, am meisten enttäusche und befremde ihn bei seiner Arbeit, dass er fast nur nach der Performance an der Abendkasse gefragt werde und dass die Programmgestaltung, das künstlerische Gelingen usw. kaum Gegenstand von Diskussionen sei. Am Anfang des 21. Jahrhunderts scheint künstlerische Autonomie endgültig zur Schimäre geworden zu sein und der Druck, das "Produkt" an einem Segment des Marktes auszurichten, allgegenwärtig, wie bewusst oder unbewusst er den Kunstschaffenden auch sein mag. Wer ihn ignoriert, riskiert, im Abseits der Nichtbeachtung zu landen. Ganz diskret und zivilisiert artikuliert der Markt jene "vox populi", die sich vor einem Jahrhundert gegen musikalische Revolutionäre wie Schönberg und Strawinsky lautstark in den Konzertsälen bemerkbar gemacht hatte.
Nachdem Aufführungen seiner Werke im Gejohle empörter Zeitgenossen untergegangen waren, zog sich Schönberg mit seiner Gruppe bekanntlich in seinen "Verein für musikalische Privataufführungen" zurück, wo Meinungsäusserungen jeglicher Art, also auch applaudierende Zustimmung, untersagt waren (während Strawinsky nach dem "Sacre"-Skandal mit der neoklassizistischen Volte sehr bald wieder die Zustimmung des Publikums fand). Mit der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik schufen sich die Komponisten dann in den 20er Jahren ein Forum, das zwar nicht so restriktiv war wie der Schönbergsche Verein, in dem sich jedoch das "gewöhnliche Volk" höchstens indirekt, etwa in Form eines musikalischen Zitats, bemerkbar machte. Paradoxerweise war es dann gerade ein Schüler Schönbergs, der die damit verbundene Isolierung der Musik am radikalsten kritisierte und die konsequentesten Schlüsse daraus zog. Davon ausgehend, dass Musik seit jeher eine ausgesprochene Gemeinschaftskunst sei, attestierte Hanns Eisler 1927 der modernen Musik, sie führe ein Scheindasein, das nur noch künstlich aufrecht erhalten werden könne. "Dem Proletariat ist sie als Privatangelegenheit gut erzogener Leute gleichgültig. Die Bourgeoisie sucht stärkere Reiz- und Unterhaltungsmittel. […] Trotz aller technischen Finessen läuft sie [sc. die moderne Musik] leer, denn sie ist ideenlos und gemeinschaftslos. Eine Kunst, die ihre Gemeinschaft verliert, verliert sich selbst."4 Die Gemeinschaft, welche Eisler anvisierte, war die von der Arbeiterklasse herbeigeführte sozialistische Gesellschaft; er selbst wollte nicht länger Zwölftonkompositionen schreiben, sondern dazu beitragen, dem Proletariat mit der Erfahrung und den Kunstmitteln der Bourgeoisie eine neue Musik anderer Art zu erschaffen. Das kam einer Gratwanderung zwischen musikalischer Innovation und Zugänglichkeit für breite Massen gleich; es bedeutete, die vertrauten Mittel neu zu organisieren – also etwa Dreiklänge und Septakkorde anders als nach den Schemata der Dur-Moll-Tonalität zu verbinden oder rhythmische Modelle wie den Marsch durch Irregularitäten aufzubrechen – und Ensembles zu konstituieren, die in ihrer klanglichen Schärfe dem streicherdominierten Wohlklang bourgeoiser Musik à la Richard Strauss opponierten.
Mit den Nazis herrschte dann der spiessbürgerlich reaktionäre Geschmack des "gewöhnlichen Volkes" und wurde die künstlerische Moderne samt Gegenmodellen Eislerscher Art diffamiert und kriminalisiert. Fatalerweise begannen sich in den 30er Jahren im Musikleben der Sowjetunion, das vordem durch grosse Offenheit und Experimentierfreudigkeit geprägt war, ebenfalls antimoderne Tendenzen durchzusetzen. Das hatte weitreichende Folgen: Die Versuche, in der Nachkriegszeit in den sozialistischen Staaten Osteuropas eine neue Musikkultur aufzubauen, blieben in den Borniertheiten der Schdanowschen5 Kulturpolitik stecken. In das Prager Manifest von 1948 konnte Eisler, der den Entwurf verfasste, zwar Einiges von seinen Vorstellungen einbringen – etwa das Postulat eines Stils, "der höchste Kunstfertigkeit, Originalität und hohe Qualität mit der grössten Volkstümlichkeit verbinden kann".6 Dass in der verabschiedeten Fassung "grösste Volkstümlichkeit" durch "echte Volkstümlichkeit" ersetzt wurde und dass der "ernsten Musik" ebenso wie der "Vergnügungsmusik" ein "falscher kosmopolitischer Charakter" unterstellt wurde, ist jedoch ein Indiz für die Engstirnigkeit, die hinter den gut gemeinten Bemühungen der in Prag versammelten Komponisten und Musikkritiker lauerte und die dann im Kampf der stalinistischen Kulturpolitiker gegen den "Formalismus" (womit u.a. die Dodekaphonie gemeint war) einerseits und Jazz, Rock-'n'-Roll usw. anderseits zum Durchbruch kam.
Was sich in der Sowjetunion und den ihr verbündeten Staaten als Musik im Sinne des "sozialistischen Realismus" etablierte, lief meist auf einen monumentalistischen Klassizismus hinaus, exemplarisch (und technisch keineswegs ungekonnt) in den Sinfonien Tichon Chrennikovs, des langjährigen Vorsitzenden des Komponistenverbandes der Sowjetunion. Selbst Dmitrij Schostakowitsch trug mit den mittleren Sinfonien sein Scherflein zu dieser Blechsammlung bei, wenngleich mit schlechtem Gewissen und deshalb manchmal ironisch verzerrt oder mit übertriebener Ostentation. Das Konzept einer politisch progressiven und zugleich ästhetisch innovativen Musik, das in der frühen Sowjetunion noch auf der Tagesordnung stand und für das ausser Schostakowitsch so bedeutende Komponisten wie Nikolaj Roslavec und Aleksandr Mosolov einstanden, war damit ad acta gelegt. Musikalische Innovation war nunmehr eine Angelegenheit der Opposition, die sich an Verfahrensweisen der verpönten westlichen Avantgarde orientierte und sich ideologisch vom "sozialistischen Realismus" prononciert absetzte. Die Adaption dieser Techniken war indessen mit einigen Vergröberungen verbunden, zum einen wohl, weil der Zugang zu den Quellen nur beschränkt möglich war, zum andern aber auch, weil diese Komponistinnen und Komponisten – wie zu zeigen sein wird – doch stärker von der in der Sowjetunion herrschenden Ästhetik geprägt wurden, als man bisher, geblendet von ihrer Oppositionsrolle, angenommen hat. "Echte Volkstümlichkeit" wird man ihnen zwar nicht unterstellen wollen, aber einen erleichterten Zugang zu avancierter Musik, sozusagen eine Volksausgabe derselben, bieten sie allemal an. Das hat ihnen einige Erfolge gebracht, zumal in den westeuropäischen Ländern, wo sie im Kalten Krieg von einem Dissidenten-Bonus profitieren konnten. Dieser allein hätte aber ebenso wenig für einen nachhaltigen Erfolg sorgen können wie der Einsatz prominenter Interpreten (allen voran jener von Gidon Kremer). Viel entscheidender ist die Konzertsaal-Tauglichkeit der Musik selbst, ihre Kompatibilität mit den rezeptiven Fähigkeiten und Bedürfnissen eines mehr oder weniger traditionellen Konzertpublikums. Was diese Kompatibilität ausmacht, sei im Folgenden anhand einiger charakteristischer Züge in den Werken von Alfred Schnittke, Sofia Gubajdulina, Edison Denisov und Gija Kancheli angedeutet.7
Als hätten sie sich Alban Bergs Aufsatz "Warum ist Schönbergs Musik so schwer verständlich?"8 ex negativo zu Herzen genommen, überfordern diese Komponist(inn)en die Zuhörenden selten durch die Gleichzeitigkeit mehrerer Ideen; vielmehr wird die Musik sozusagen in Sektionen aufgeteilt, denen je ein Strukturprinzip zugrunde liegt. Insbesondere bei Sofia Gubajdulina ist eine solche Aneinanderreihung von Patterns häufig zu finden, was sicher auch von ihrer Improvisationspraxis herkommt. Manchmal werden die Sektionen ihrerseits durch eine Werkidee und deren lineare Abwicklung zusammengehalten. Sie besteht etwa im 4. Streichquartett (1993) darin, dass die Klänge, welche auf die Saiten aufspringende Gummibällchen erzeugen, zunächst ab Tonband dem Quartett zugespielt werden, dass dieses dann mit den Fremdklängen in einen Dialog tritt und sie am Schluss selbst erzeugt. Parallel dazu soll das Dunkel, aus dem die Tonbandklänge auftauchen, in ein Spiel von Licht und Farben verwandelt werden – als wäre die Werkidee nicht schon simpel genug, wird sie auch noch optisch umgesetzt. Das Rätsel, das die Komponistin am Anfang aufgibt, löst sie mit der Enthüllung der Gummibällchen gleich selber.
Auch Alfred Schnittkes Formpläne beruhen oft auf der Aneinanderreihung von Sektionen, die durch Korrespondenzen und Symmetrien ein übergeordnetes Ganzes bilden, im einzelnen aber durch krude und frappierende Entgegensetzungen auffallen. Diesen Effekt erzielt Schnittke häufig durch Montage von Stilzitaten, aber auch etwa durch überfallartig einsetzende Orchestertutti. Als Beispiele seien der 2. und 5. Satz des Concerto grosso I (1976/77) genannt, wo der Pseudobarock in einen Walzer bzw. einen Tango umkippt und dann der Walzer seinerseits durch wilde hereinfahrende Orchestertremoli unterbrochen wird; oder das Cellokonzert (1985/86), wo der solistische Monolog nach ca. zwei Minuten von der geballten Macht des Orchesters abgeklemmt wird. Einen noch spektuläreren Effekt erzielt Gija Kancheli, wenn er am Anfang der 5. Symphonie (1976) ein zartes Cembalosolo in C-Dur mit einer ungestümen Geste des Orchesters unterbricht. Das Überrumpeln ist hier kompositorische Strategie und nicht etwa eine humoristische Einlage wie bei Haydns berühmtem Paukenschlag (im 2. Satz der Symphonie Nr. 94). In dieser Musik wimmelt es von "Paukenschlägen".
Aparte Klangfarben wie die des Cembalos in einem ihnen eigentlichen fremden Kontext begegnen nicht nur bei Kancheli; in Schnittkes Concerto grosso I gehört zwar das Cembalo zum barocken Modell, nicht aber das mit Münzen präparierte Klavier, das zusätzlich aufgeboten wird. Gubajdulina spekuliert in ihrem Gummibällchen-Streichquartett ebenfalls auf den Reiz, den der fremde Klang dem Standardensemble hinzufügt. Das Quartett als Inbegriff der "reinen" Musik und Domäne der "Kenner" wird so für ein breiteres Publikum attraktiv, ganz im Sinne des Crossover-Konzepts des Kronos-Quartetts, für welches dieses Stück geschrieben wurde.
Besonders gerne halten es diese Komponisten mit den Glocken, nicht nur ihres Klangreizes wegen, sondern auch wegen ihres symbolischen Gehalts. Kancheli lässt seine 4. Symphonie mit Glockengeläut beginnen, in dessen meditative Ruhe dann ein Crescendo mit der Kraftentfaltung des ganzen Orchesters einbricht. Schnittke nutzt im Cellokonzert die Röhrenglocken, um die Steigerungen im 2. und 4. Satz mit einer weihevollen Aura zu umgeben. Denisov setzt mit Glocken- und Vibraphonklängen den Zuckerguss auf die Stimmenknäuel seiner Symphonie bzw. Kammersymphonie.
Mit dem Verströmen von Pathos sind sie alle nicht zimperlich. Insbesondere Schnittke und Kancheli zielen mit ihrer Musik unablässig auf Beeindruckung, und sie schrecken vor demagogischen Wirkungen nicht zurück, wenn sie den Orchesterapparat hochpeitschen und dessen Schlagkraft ausspielen. Gegen Ende des ersten Satzes von Schnittkes Cellokonzerts mündet dieses Hochpeitschen in die Gewalt eines Unisono, die Steigerung am Schluss des zweiten führt zur Marschiermusik des dritten, die dann im vierten in ein leises Largo mit stehendem Bass (einem Orgelpunkt auf d) und verhaltenen Paukenrhythmen umschlägt, auf der sich Kantilenen des Solocellos entfalten.
Man kann allerhand Inhalte in solche Musik hineinlesen oder aus ihr heraushören, und das ist durchaus im Sinne des Komponisten, der offenbar seine Musik allegorisch konzipiert hat, aber diese Allegorien zu Sowjetzeiten für sich behielt oder nur nahestehenden Personen mitteilte. Im Falle des 2. Violinkonzerts (1966) hat Schnittke im Gespräch mit seinem Schüler Dmitrij Schulgin die religiöse Thematik enthüllt, die dem Werk zugrundeliegt und aus deren inhaltlichem Konzept sich alle strukturellen Zuordnungen erklären: "Solist und Streicher (Jesus und seine Jünger) werden linearthematisch behandelt; die kontrastierende Gruppe von Bläsern und Schlagwerk (die feindselige Menge und die Exponenten der Macht) sind aggressiv punktuell und aleatorisch eingesetzt. Der Kontrabass (Judas) hat die besondere Rolle eines karikierenden 'Antisolisten'."9 Das aber ist nichts anderes als Inhaltsästhetik im Geiste Schdanows, nur dass nicht Stalin oder Lenin, sondern Jesus die Lichtgestalt ist; an der Stelle des imperialistischen Feindes stehen (zusammen mit den "Exponenten der Macht") Judas und "die feindselige Menge", deren Charakterisierungen durch einen näselnden Kontrabass bzw. schrille Holzbläserfiguren und groteske Blechbläserglissandi verhängnisvollen antisemitischen Topoi folgt. Die Umsetzung bedient sich primitivster Rezepte der Programmusik: So wird die Versammlung der Jünger durch Imitationen des Themas der Sologeige dargestellt und die Vereinigung im Glauben durch ein Unisono ebendieses Themas; der "Judas"-Kontrabass trägt dagegen das "Jesus"-Thema in Umkehrung mit Entstellungen vor usw.
Auch Sofia Gubajdulina hält es mit religiösen Sujets, ohne freilich mit solch handfester Programmatik aufzuwarten und sich auf derart verfängliche Thematik einzulassen. Ihre Musik kommt ohne jenes ständige Aufheizen des Apparats aus, das Schnittke und Kancheli so lieb und teuer ist. Zu den bevorzugten Verfahrensweisen Gubajdulinas, z.B. in "Sieben Worte" (1982) und im Klavierkonzert "Introitus" (1978), gehören vielmehr das geduldige Umkreisen einzelner Töne und das Erzeugen von Klangbändern durch ein Auffächern der Stimmen. Es passiert wenig in dieser Musik. Die Redundanz ist gross und zielt auf eine der Meditation sich hingebende Hörgemeinde. Ein aktiv die musikalischen Strukturen erkundendes Publikum kommt hier nicht auf seine Rechnung, es ist schlicht unterbeschäftigt.
Polyphon sich verflechtende, aber im Grunde Homophonie anvisierende Stimmen sind auch ein Hauptrezept Edison Denisovs, der gerne auf konturlose, wenig charakteristische Gestalten zurückgreift, um ein dichtes Gewebe zu erzeugen. In seiner Symphonie von 1987 entstehen so grossdimensionierte bewegte Klangfelder; die mit 12 Instrumenten besetzte Kammersymphonie von 1982 trägt naturgemäss weniger dick auf, ohne dass das Verfahren prinzipiell ein anderes wäre. Die Verständlichkeit auf Anhieb erreicht Denisov gerade durch strukturelle Undeutlichkeit: Das Ungefähr der Mikrostrukturen entbindet vom genauen Zuhören; dem grossen Ganzen zu folgen ist wegen der Grobschlächtigkeit der Makrostruktur selbst dann noch möglich, wenn man dazu die Annoncen im Programmheft liest oder vor sich hin döst. Im Grunde verlangt jede Haydn-Symphonie ein Vielfaches an Aufmerksamkeit: Wenn man dort den Faden der motivischen Entwicklungen und den Überblick über die Formteile verliert, kann man den Sinnzusammenhang der Musik nicht nachvollziehen, und nur weil die Harmonik auf einem bekannten System beruht, scheint sich auch bei unkonzentriertem Hören eine Art Sinn herzustellen – ein trügerischer aber, denn er beruht bloss auf der Logik des tonalen Systems und erfasst die der Komposition nicht. Umgekehrt signalisiert die Abwesenheit des tonalen Systems bei unerfahrenen Hörern "Unsinn" und hindert sie daran, etwas zu verstehen, was keine Kenntnisse, sondern höchstens – wegen der Ausführlichkeit solcher Kompositionen – Geduld verlangt (Denisovs Symphonie dauert nicht weniger als fünfzig Minuten).
Tonalität als System wurde von den "dissidenten" sowjetischen Komponisten gemieden, da sie das Terrain der "offiziellen" Komponisten war.10 Auffallend häufig aber begegnen als Relikt von Tonalität liegende Töne im Bass, sogenannte Orgelpunkte: bei Denisov etwa im 3. Satz der Kammersymphonie, bei Schnittke sowohl im Concerto grosso I wie im Cellokonzert als eines der konstituierenden Elemente (um bei den in diesem Aufsatz erwähnten Werken zu bleiben). Kancheli, der sich ohnehin nie ganz von der Tonalität getrennt hat (so wie er auch nicht zur "Dissidenz" gehörte), macht in neueren Werken wie dem Violakonzert "Vom Winde beweint" von 1990 oder der Kammerkantate "Exil" von 1994 so ausgiebigen Gebrauch von Orgelpunkten, dass geradezu von einer Orgelpunkt-Tonalität gesprochen werden muss. Der Orgelpunkt, in tonaler Musik ein Mittel für hervorgehobene Momente (z.B. für Schlüsse oder für den Aufbau einer Spannung, die sich dann mit der Aufhebung des Orgelpunkts löst), wird so vom Sonder- zum Normalfall – auch in diesem Belang ist also ein hochdosierter Einsatz starker Mittel zu konstatieren. Wie im Circulus vitiosus einer Sucht führt das zur Gewöhnung und damit zum Bedarf an immer stärkeren Mitteln. Genau diese Eskalation ist es, welche solche Musik zunächst so "eindrücklich" erscheinen lässt – und bald einmal hohl: Da einem der Komponist alles mit Macht aufdrängt, gibt es in ihr nichts zu entdecken. Den Zuhörenden bleibt nichts anderes übrig, als die Botschaft passiv zu empfangen (oder sich ihr zu verweigern). Unter dem Aspekt der Kommunikation funktionieren solche Werke ähnlich wie Propagandakunst.
Es liegt nahe, im Zusammenhang unserer Thematik einen Blick auf die Entwicklung Krzysztof Pendereckis zu werfen. Er gehörte zur kompositorischen Avantgarde in einem Land, in dem zwar ebenfalls die Kommunistische Partei herrschte, wo sich aber die musikalische Moderne nach 1956 vergleichsweise problemlos durchsetzen konnte und mit dem "Warschauer Herbst" eines der führenden Festivals für zeitgenössische Musik bestand. Vielleicht gerade deswegen hatte Penderecki nicht das Bedürfnis, auf seinem Weg zurück einen Bogen um die Tonalität zu machen. Hatte er es mit Werken wie "Threnos. Den Opfern von Hiroshima" oder der Lukas-Passion schon in den 60er Jahren verstanden, mit Techniken der neuen Musik eindrucksvolle Wirkungen wie in der alten zu erzielen, so kehrte er um 1980 auch zu den alten Mitteln zurück. Die 2. Symphonie hebt an mit chromatisch grübelnden Streicherbässen und düsteren Mollakkorden im Blech, um bald einmal den Anfang von "Stille Nacht, heilige Nacht" zu zitieren; ein bewegter Seitensatz mit einem scherzandoartigen Abschnitt in Es-dur führt zu einer Klimax mit furchterregenden hohen Trillern, worauf unweigerlich der Zusammenbruch folgt, aber keineswegs das Ende des Stücks, denn dieses ist ein ausgewachsener Sonatensatz mit Exposition, Durchführung und Reprise. In der Reprise gelingt es Penderecki, die Klimax der Exposition noch zu überbieten: sie mündet in ein hymnisches Trompetenmotiv in Es-Dur und von dort in ein minutenlanges Gedonner und Gedröhne, ehe – entsprechend der heiligen Dreifaltigkeit zum dritten und letzten Mal – das "Stille Nacht"-Zitat erscheint (in der Tonart der heiligen Einfalt, C-Dur, in der das Lied meistens gesungen wird). Das Weihnachtslied wird nicht in die Verarbeitungsprozeduren in diesem rund halbstündigen sinfonischen Einsätzer einbezogen, sondern gleichsam als Chiffre einer heilen Welt in jeden der drei Teile einmal interpoliert. Von Sinfonik im Geiste des "sozialistischen Realismus" unterscheidet sich dieses Stück zwar in der Intention – Penderecki bietet eine reaktionäre, keine zukunftsgerichtete Utopie an, und sein aufgewühlter Sinfoniesatz endet resignativ –, aber kaum in der Ästhetik: die gleichen aufgewärmten alten Formen, musiksprachlichen Klischees, Imponiergesten usw.
In manchen Zügen (und an einigen Stellen) erinnert Pendereckis neu-alte Symphonik an den mittleren Schostakowitsch, der nach der scharfen Kritik an der 4. Symphonie und "Lady Macbeth von Mzensk" auf die "Hauptstrasse der sowjetischen Kunst"11 eingeschwenkt war. Dass Schostakowitschs Fünfte nicht nur die Zustimmung der sowjetischen Kunstinstanzen fand, sondern auch im Westen zu einem Erfolgsstück wurde (im Gegensatz zur Vierten, die erst im Zusammenhang mit der generellen Schostakowitsch-Aufwertung in den 80er und 90er Jahren hie und da in den Konzertprogrammen auftauchte) ist ein Konvergenzphänomen, welches bestätigt, dass in der Kunst allemal die Ästhetik schwerer wiegt als Intention und Inhalt. (Ein schlagendes Beispiel dafür lieferte jüngst der FAZ-Herausgeber Johann Georg Reissmüller, der als notorischer Antikommunist mit zwar zittriger Stimme, aber unverkennbarer Inbrunst Lieder aus der frühen DDR, darunter Titel wie "Stalin, Freund, Genosse" und "Mit Walter Ulbricht kämpft sich's gut" auf eine CD bannte.)12
Auch wenn das Auftrumpfen in Schostakowitschs 5. Symphonie eine "versteckte kritische Bedeutung" haben mag,13 bleibt das Werk ein Exempel von musikalischem Populismus, das seine Wirkung weder hüben noch drüben verfehlt hat. Die verordnete Simpelkeit und Affirmation hat sich als Erfolgsrezept auch für den kapitalistischen Musikbetrieb erwiesen, und mancher amerikanische Komponist, der Orchesterwerke nach dem Gusto der Sponsoren schreibt, dürfte davon gelernt haben.
Die Anbiederung an ein primitives Musikverständnis hat freilich die fatale Tendenz, sich selbst überflüssig zu machen. Wenn neue Kompositionen nichts Neues mehr bringen, sind sie nichts weiter als Feigenblätter, die gerade so lange gebraucht werden, als eine gewisse Scham besteht, sich dazu zu bekennen, dass man einen Musikbetrieb, der nach den Gesetzen des Marktes funktioniert, am besten mit den sogenannten Big Forty bestreitet, d.h. mit den vierzig berühmtesten Titeln der Vergangenheit und den prominentesten Interpretennamen der Gegenwart. Mit dem Begriff "Interpretationskultur" ist diese Entwicklung bereits musikologisch nobilitiert worden. Der Autor des Artikels "Interpretation" in der neuen MGG, Hermann Gottschewski, bezeichnet in seinem Buch "Die Interpretation als Kunstwerk" die h-Moll-Sonate von Liszt in Horowitz' Interpretation von 1932 allen Ernstes als eine der "bedeutendsten musikalischen Schöpfungen des 20. Jahrhunderts" und bedauert, dass es darüber noch keine Dissertation gibt.14 Es handelt sich also bei den heutigen populistischen Konzepten um eine Rückzugsstrategie, die kurzfristig vielleicht einige Erfolge versprechen mag, langfristig aber die Komponiertätigkeit im Bereich der sogenannten E-Musik überhaupt in Frage stellt.
Letztlich bleiben Versuche, "populäre" Musik für das etwa bei fünf Prozent limitierte "Klassik"-Marktsegment zu schreiben, ohnehin hilflos. Der moderne Orpheus in Salman Rushdies neuem Roman "The ground beneath the feet" heisst Ormus Cama15 und ist ein Rockstar. Die nach Popularität schielenden E-Musik-Komponisten, weit entfernt davon, ein zeitgemässes Lebensgefühl auszudrücken, versehen dagegen bloss einen musealen Musikbetrieb mit frischer Tünche, zu einem ästhetisch hohen Preis. Man muss ja nicht wie Schönberg sich nach kunstsinnigen Fürsten zurücksehnen, wenn man der Ansicht ist, dass die Marktwirtschaft und ihr politisches Äquivalent, die parlamentarische oder gar die direkte Demokratie, nicht der beste Boden für Musik als Kunst ist, und dass gerade die feineren Pflanzen dort leicht verdorren. Dennoch erscheint es mir als bessere Variante, an einer gewissermassen "aristokratischen" Kunstauffassung festzuhalten und keinerlei Konzessionen im Anspruch an die Zuhörenden zu machen, als mit musikalischem Populismus den Markt bedienen zu wollen.
Um Missverständnissen vorzubeugen: Mit diesem Fazit und der vorhergehenden Kritik will ich in keiner Weise auf die Gleichungen einfach=schlecht=erfolgreich bzw. komplex=gut=erfolglos hinaus. Komplexität als solche ist weder eine kompositorische Qualität noch ein moralisches Verdienst; im übrigen ist sie mit heutigen Kompositionstechniken ziemlich leicht herstellbar. Andererseits ist es durchaus möglich – wenngleich viel schwieriger –, Einfachheit und leichte Zugänglichkeit mit höchster Kunstfertigkeit und Originalität zu verbinden. Eisler, der dies gefordert hatte, hat es in manchen seiner Stücke bewiesen; oder auch – um ein Beispiel aus neuerer Zeit und ganz anderer Richtung zu nennen – György Kurtág. Zu guter Letzt ist es nicht einmal so, dass schwierige neue Musik zwangsläufig erfolglos bleiben muss. Im Glücksfall mag die künstlerische Gestaltungskraft so stark sein, dass auch ein nicht-spezialisiertes Publikum von einem innovativen und komplexen Werk berührt werden kann. Ich erinnere mich an eine Aufführung von Helmut Lachenmanns Oper "Das Mädchen mit den Schwefelhölzern" in Hamburg, der – abgesehen von ein paar Türknallern – ein voller Saal mit grösster Aufmerksamkeit selbst in den leisesten geräuschhaften Passagen folgte. Das war möglich in einer Stadt, welche das zeitgenössische Musiktheater seit Jahrzehnten gefördert hat; weitere Voraussetzungen waren ein hartnäckiger Intendant, ein Komponist, der es sich nicht leicht macht, ebenso engagierte wie kompetente Ausführende und schliesslich eine kontroverse Presse, welche die Neugier anstachelte. Ohne das Ingenium des Komponisten wäre aber alles vergebliche Liebesmüh' gewesen. (Etwas Geniekult muss erlaubt sein.)
1 Eric Hobsbawm, "Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts", München 1998, S. 716.
2 siehe Neue Zürcher Zeitung vom 29. Juni 2001, S. 79: "Wachsendes Bedürfnis nach genauen Daten. Boomende Schweizer Marktforschung".
3 Mathias Spohr, "Der Komponist im Medienzeitalter – von der ŒBerufung&Mac185; zurück zum Beruf", in Dissonanz Nr. 23 (Februar 1990), S. 20-23.
4 Hanns Eisler, "Über moderne Musik", in "Die Rote Fahne" (Berlin), 15. Oktober 1927; siehe Hanns Eisler, "Musik und Politik. Schriften 1924–1948", Leipzig 1973, S. 31–33.
5 Andrej Alexandrowitsch Schdanow (1892–1948) war unter Stalin im Politbüro der KPdSU für Kulturpolitik zuständig.
6 Hanns Eisler, "Musik und Politik. Schriften 1948–1962", Leipzig 1982, S. 27.
7 Von diesen Komponist(inn)en ist Kancheli am spätesten im Westen bekannt geworden, in breiterem Masse erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Er kann kaum zur "Dissidenz" gerechnet werden, denn er war ein preisgekrönter Komponist, der zeitweise dem Vorstand des Georgischen Komponistenverbandes angehörte. Dass seine Werke mit denen der andern hier erwähnten Komponist(inn)en manche gemeinsame Züge aufweisen, mag die hier vertretene These von der breiten Wirksamkeit des herrschenden populistischen Kunstverständnisses zusätzlich belegen. Die vier Komponist(inn)en gehören einer Generation an (sie sind zwischen 1929 und 1935 geboren), deren Ausbildung noch unter den Prämissen der Stalin-Ära stand. Im übrigen ist die Auswahl etwas zufällig oder willkürlich; sie hätte aber mit anderen bekannten Komponisten nicht zu grundlegend verschiedenen Schlüssen geführt.
8 Berg führt die Schwierigkeiten beim Hören von Schönbergs Musik auf den thematischen, kontrapunktischen, rhythmischen und harmonischen Reichtum auf engstem Raum zurück, mit den ersten zehn Takten des Streichquartetts d-Moll op. 7 (samt simplifizierenden Alternativen) als Demonstrationsobjekt.
9 Jürgen Köchel im Begleitheft zu der bei Teldec erschienenen CD, welche die Violinkonzerte Nr. 2 und 3 sowie zwei kleinere Werke Schnittkes in der Interpretation von Gidon Kremer enthält.
10 Die Grenzen sind fliessend, deshalb die Anführungszeichen; siehe auch Anm. 7.
11 Bereits 1929 wurde Schostakovitsch in der Zeitschrift "Proletarskij muzykant "(Der proletarische Musiker) vorgehalten, er habe sich mit der Gogol-Oper Die Nase "entschieden von der Hauptstrasse der sowjetischen Kunst entfernt", und gefolgert: "Falls er nicht versteht, dass er auf dem Holzwege ist, wenn er nicht versucht, die vor seiner Nase existierende, lebendige Wirklichkeit zu begreifen, dann gerät sein Schaffen unvermeidlich in eine Sackgasse.", siehe Dissonanz Nr. 55 (Februar 1998), S. 17.
12 "Uns gefällt diese Welt. Lieder der frühen DDR", Biton Production 1999, BIT 4007, im Verlag von Zweitausendeins.
13 Diese Ansicht vertritt Jacques Wildberger in seiner Analyse des Werks ("Meisterwerke der Musik", Heft 53, München 1989). Bei Solomon Volkow, "Zeugenaussage. Die Memoiren des Dmitrij Schostakowitsch" (Frankfurt a.M. 1981), ist von "erzwungenem Jubel" die Rede.
14 Hermann Gottschewski, "Die Interpretation als Kunstwerk", Laaber 1996, S. 16.
15 Neben der offensichtlichen Assoziation von Orpheus und Musik enthält der Name eine versteckte Anspielung auf Bono, den Sänger der irischen Rockband U2, der seinerseits aus einer Passage von Rushdies Roman einen Song kreiert hat.
© 2009 Christoph Keller. Alle Rechte vorbehalten.